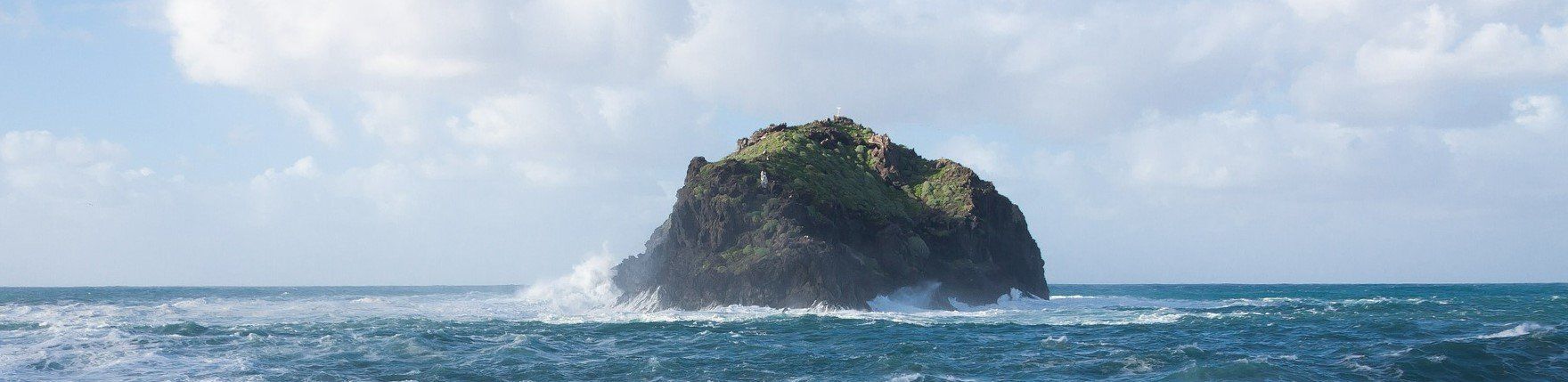Wer zu spät kommt, den …?
blog@susannearmbruster.de
Berühmte Zitate und ihre Folgen

„Wer zu spät kommt, den beißen die Hunde“?
„Hups, was ist denn hier passiert? Der Satz macht ja Sinn, aber irgendwas ist da schiefgelaufen …“ Nach der ersten Irritation über diese Äußerung im Interview-Artikel einer Frauenzeitschrift hier die einmal etwas ausführlichere Analyse der beiden miteinander vermengten Wendungen:
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben
Die Generation, die die Öffnung des Ostens und den Mauerfall live miterlebt hat, vervollständigt den oben genannten Halbsatz meist noch nach dem inzwischen geflügelten Wort, das Michail Gorbatschow zugeschrieben
wird.
„Zugeschrieben“, denn tatsächlich hat der ehemalige Staatspräsident der Sowjetunion dies nie so gesagt. Protokolliert ist wohl die Warnung Gorbatschows an Erich Honecker vom 7. Oktober 1989, sich einer Erneuerung der DDR zu widersetzen, in der nahezu wortwörtlichen Übersetzung: „Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren.“ Übersetzt wurde die Äußerung damals von zwei deutschen Journalisten, die sich auf eine Interpretation des Originals einigten, und zwar in der griffigen Wendung: „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“ Über den Nachrichten-Ticker verbreitet, fand der Satz in seiner Formelhaftigkeit
schnell Verbreitung und wurde alsbald zum geflügelten Wort.
Den Letzten beißen die Hunde
Diese Wendung geht auf Beobachtungen bei der Hetzjagd
zurück. Oft wird das langsamste, schwächste und älteste Tier einer Herde das Opfer der Hundemeute: Es bleibt zurück, wird von den Hunden gestellt und gebissen. Die schon ungünstige Position als in der Herde letztes Tier wird in der Jagd zum Verhängnis. Ein erster Beleg für die Wendung findet sich 1605
in „Der Teutschen Weissheit“ von Friedrich Petri. Interessanterweise ist es dort noch „Veritatem“, die Wahrheit, die gebissen wird (siehe Scan 568
der Bayerischen Staatsbibliothek).
In der Redensart im heutigen Gebrauch schwingt die Benachteiligung
des Letzten (Großschreibung der Substantivierung, D72) noch immer mit: Im Vergleich zu anderen in einer Gruppe ohnehin schon mit schlechteren Chancen ausgestattet, ist der Letzte in einer stressigen Situation dann auch der Leidtragende. Meiner Beobachtung nach hat diese Metapher noch eine Bedeutungserweiterung
erfahren, indem heute der Letzte für sein Schicksal selbst verantwortlich gemacht wird: Der Letzte ist der Zu-spät-Kommende, der früher hätte kommen können und daher selbst daran schuld ist, nun eine unangenehme Aufgabe übernehmen zu müssen.
Last but not least wurde die Wendung 1974 zum Filmtitel
einer melodramatischen Gangsterkomödie. Das Original „Thunderbolt and Lightfoot“ (mit Clint Eastwood und Jeff Bridges) firmiert im deutschen Verleih als „Die
Letzten beißen die Hunde“ – im Plural
also schon weit von der ursprünglichen Metaphorik entfernt.
Keine Amalgamierung, aber Kontamination der beiden Wendungen
Der sprachwissenschaftliche Begriff „Kontamination“ (von lat. contaminare: „in Berührung bringen“, „verschmutzen“) wurde 1880 von Junggrammatiker Hermann Paul
in den „Principien der Sprachwissenschaft“ (Kapitel 8, zitiert nach der Auflage von 1920) geprägt:
„Unter Kontamination verstehe ich den Vorgang, dass zwei synonyme oder irgendwie verwandte Ausdrucksformen sich neben einander ins Bewusstsein drängen, so dass keine von beiden rein zur Geltung kommt, sondern eine neue Form entsteht, in der sich Elemente der einen mit Elementen der andern mischen. Auch dieser Vorgang ist natürlich zunächst individuell und momentan. Aber durch Wiederholung und durch das Zusammentreffen verschiedener Individuen kann auch hier wie auf allen übrigen Gebieten das Individuelle allmählich usuell werden. Die Kontamination zeigt sich teils in der Lautgestaltung einzelner Wörter, teils in der syntaktischen Verknüpfung.“
In „Wer zu spät kommt, den beißen die Hunde“ werden das geflügelte Wort und die Redensart verbunden – grammatisch und auf syntaktischer Ebene vollkommen korrekt. Auch inhaltlich lässt sich eine gewisse Verwandtschaft auf der Bedeutungsebene
ausmachen (Nähe von „zu spät kommen“ und „der Letzte sein“; ebenso der „Nachteil“, in dem beide Wendungen kulminieren). Dennoch führt die Verbindung zu einer stilistisch falschen Wendung. Insofern liegt hier noch keine Amalgamierung
vor, bei der zwei Bestandteile in eine neue Form verschmolzen würden.
Die syntaktische Form „funktioniert“ zwar, doch die Inhalte haben sich nebeneinander
ins Bewusstsein gedrängt und bleiben noch als separierte erkennbar. Wird die Kontamination nicht bewusst in einem humoristischen Rahmen eingesetzt, so ist davon auszugehen, dass es sich nicht um die intentionale Prägung eines Wortschöpfers, sondern vielmehr um einen „Versprecher“
handelt, der aus der verwandten Bedeutung und vagen Erinnerung an beide Wendungen resultiert.
Kontaminationen
auf Laut-, Wort- oder Satzebene beweisen immer wieder eindrucksvoll, dass Sprache kein statisches, in grammatischen Kategorien zu definierendes Konstrukt ist, sondern über eine starke Dynamik
verfügt und jedem Sprecher unzählige Möglichkeiten zur Verfügung stellt, sich auszudrücken und kreativ zu werden.
Im Lektorat
Aus rechtlichen Gründen wird der Wortlaut eines Interviews von der Redaktion mit den Interviewten abgestimmt und freigegeben. Zitate
werden in der Schlussredaktion bzw. im Lektorat daher lediglich orthografisch und grammatisch den Regeln der deutschen Rechtschreibung angepasst – inhaltlich aber normalerweise nicht angetastet. Der O-Ton, oft auch den Holprigkeiten gesprochener Sprache geschuldet, wirkt oft authentischer als eine geglättete, syntaktisch einwandfreie Struktur (Ausnahmen je nach Textsorte).
Neben der Authentizität
ist jedoch auch die Darstellung
der interviewten Personen ein Kriterium: Berichten zum Beispiel Betroffene über ein schweres Schicksal, kann eine sprachliche Kontamination lächerlich
wirken, die Interviewten verlieren an Glaubwürdigkeit, der Spannungsbogen der Geschichte bricht, im schlimmsten Fall folgen die Leser dem Textfluss nicht weiter.
Daher muss im Kontext
entschieden werden: Bleibt die Kontamination als Interview-Zitat bestehen? Oder wird das Zitat aufgebrochen und zugunsten entweder des geflügelten Wortes oder der Redensart wiedergegeben? In solchen Fällen wird mit der Redaktion Rücksprache
genommen.